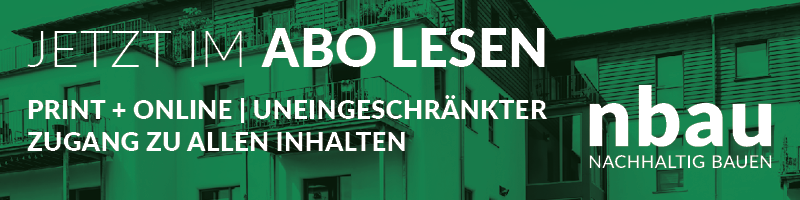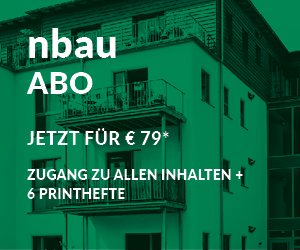GIMA-Klinker und MOEDING-Keramik für das Heizkraftwerk Leipzig Süd
Anzeige
Einen Bau- und Meilenstein auf dem Weg zur Wärmewende bildet in Leipzig das neue Heizkraftwerk Süd (Bild 1). Statt eines ehemaligen Kohlekraftwerks steht auf dem Gelände an der Bornaischen Straße eine Anlage, die für eine klimaneutrale Zukunft ausgelegt ist. Mit Wasserstofftechnologie – und nach geplanter Erweiterung auch durch Solarthermie – soll hier künftig das Fernwärmenetz versorgt werden. Baulich orientierten sich die Planer von Atelier ST am denkmalgeschützten Bestand auf dem Gelände sowie der kleinteiligen urbanen Nachbarbebauung. Das Ergebnis: Ein Farb- und Fassadenspiel aus Klinker und Keramik der beiden Spezialisten von GIMA und MOEDING, das – analog zum weiterentwickelten Inhalt – der Typologie Kraftwerk ein ganz neues Gesicht verleiht. Dafür wurde Atelier ST 2024 für den Deutschen Fassadenpreis in der Kategorie Das besondere Detail nominiert.
Visionäres Gesamtkonzept
Das Heizkraftwerk im Süden von Leipzig ist das Vorzeigeprojekt der sächsischen Großstadt. Zwei hocheffiziente Gasturbinen mit jeweils 62,5 MW elektrischer Leistung sorgen hier in Kombination mit moderner Brennertechnologie und Heißwassererzeugern sowie speziellen Katalysatoren, die die Stickstoffoxid- und Kohlenmonoxidemissionen weit unter die gesetzlichen Grenzwerte reduzieren, für Wärmeenergie. Im 60 m hohen Turm, dem sog. Koloss von Lößnig , wird das Warmwasser gespeichert und bei Bedarf – im Fall einer Flaute von Wind- und Sonnenenergie – in das Fernwärmenetz gespeist. Der Speicherturm hat eine Kapazität von 43.000 m³ Wasser, wodurch 700 Haushalte ein Jahr lang versorgt werden könnten. Die Besonderheit des HKW Leipzig Süd liegt jedoch auch in seinem visionären Gesamtkonzept. Bereits jetzt könnten die Gasturbinen hohe Anteile von Wasserstoff verbrennen. Zukünftig soll die Anlage vollständig auf die erneuerbare Energieform umgestellt werden. Auch eine bauliche Erweiterung für eine Solarthermieanlage ist auf dem Gelände geplant.
Historische Fabrikarchitektur abwechslungsreich ins Heute übersetzt
Die bauliche Übersetzung des ersten zertifizierten Wasserstoffkraftwerks Deutschlands verspricht ihrerseits ein Zeichen zu setzen. So übertrugen die Architekten des Leipziger Büros Atelier ST Merkmale historischer Fabrikarchitektur in die heutige Zeit. Die Fassaden dreier Baukörper galt es im Zuge eines Werkstattverfahrens von 2020 zu entwerfen. Für das Kraftwerksgebäude, die Pumpenhalle sowie das Gasanlagengebäude sah der Gewinnerbeitrag von Atelier ST abwechslungsreiche Gebäudehüllen vor, die farblich und in der Struktur divergent, im Material jedoch kohärent sind und eine Brücke zum Kontext schlagen.
So bestand laut den Architekten bereits im Wettbewerb die Herausforderung darin, die großen Gebäudevolumen des neuen Kraftwerks in die kleinmaßstäbliche Nachbarbebauung passend zu integrieren. Diese reicht von teils denkmalgeschützter Industriearchitektur auf dem Areal mit Sichtmauerwerk in den Farben Rot, Braun und Gelb bis hin zu gründerzeitlicher Wohnbebauung im unmittelbaren städtischen Umfeld. Die Antwort lieferte der Vorschlag einer heterogenen Fassadengestaltung für die Anlagengebäude, der das Denkmalamt, das Stadtplanungsamt sowie die Nachbarschaft gleichermaßen überzeugte.
Vom Klinkersockel zur Terrakottafassade
Der Massivität der nahezu durchgängig geschlossenen Außenwände wird durch unterschiedliche Höhenstaffelungen entgegengewirkt. Die Sockel sind jeweils mit Klinkersteinen bekleidet, die im wilden Verband gemauert und durch Lisenen rhythmisiert sind (Bild 2). Darüber schließen die Wandflächen jeweils mit einer vorgehängten, leicht vorspringenden Fassadenbekleidung aus vertikalen, unterschiedlich langen Keramikplatten ab. Farblich sind die beiden Materialien je Bauwerk einheitlich in einem Rot-, einem Ocker- und einem Gelbton gestaltet. Der Übergang zwischen Klinkersockel und Terrakottafassade ist jedoch nicht herkömmlich waagerecht, sondern verläuft diagonal und zeichnet die Konturen der umgebenden Dachlandschaften nach (Bild 3). Dadurch entsteht ein lebendiges, fein strukturiertes Fassadenbild, das durch die unterschiedliche Farbgebung je Bauwerk zusätzliche Dynamik erfährt.
Am Sockel wurde ein Klinkersonderformat von GIMA in den Maßen 252 mm × 122 mm × 69 mm eingesetzt, das dem vorhandenen Steinformat der Bestandsbebauung nachempfunden ist. Die Klinker mit den drei neu geschaffenen Farbtypen Lamone bunt, Econi und Umbra wurden speziell im hauseigenen Labor entwickelt. Diese sind größtenteils unglasiert verbaut, wobei einzelne Binder aus grün glasierten Klinkern – in Anlehnung an den Altbestand – eingestreut sind.
Bei der Gestaltung der Außenflächen orientierten sich Planerinnen und Planer am Farbspiel der Fassaden. Sie entschieden sich für den GIMA Pflasterklinker Toskana im Format 240 mm × 118 mm × 71 mm. Er bildet durch seine bunte Vielfalt von gelb bis rot das Farbspiel der Gebäude im Kleinformat optimal nach.
Unregelmäßige Struktur in harmonierenden Glasurfarben
Oberhalb der Sockel entschieden sich die Architekten für dreidimensional strukturierte Keramikplatten von MOEDING (Bild 4). Für die objektbezogen erarbeiteten Plattenformen galt es, die technischen Anforderungen an Stabilität mit den ästhetischen Wünschen zu kombinieren. Zum Einsatz kamen 70 mm starke doppelschalige Platten mit einer unregelmäßig aufgefalteten Struktur. Die unterschiedlich angewinkelten Flächen auf den Oberflächen führen zu einer Plastizität der Wände, die an einen Vorhang erinnert.
Dazu tragen auch die drei unterschiedlichen, miteinander harmonierenden Glasurfarben bei. Semiglänzende Glasuren erfüllten hier den Wunsch der Architekten und des Bauherrn, einen gewissen Glanz mit nur moderater Spiegelung der Fassade zu realisieren. Während für die Pumpenhalle und das Gasanlagengebäude zwei unterschiedliche warme Rottöne ausgewählt wurden, erhielt das dominierende Kraftwerksgebäude eine natürlich wirkende gelbe Glasur mit einem leichten Rotstich. Damit behält jeder Baustein des Ensembles seine individuelle Note, wobei das gemeinsame Gestaltungskonzept klar ablesbar bleibt.
Das Projekt profitierte deutlich von der engen Zusammenarbeit zwischen den Planenden und den Herstellern sowie den werkeigenen Synergien von GIMA und MOEDING. So arbeiteten die Architekten von Anfang an mit Mustern und Referenzen der Ziegelspezialisten und näherten sich mithilfe der kompetenten Beratung während mehrerer Planungsphasen dem allseits zufriedenstellenden Ergebnis an.