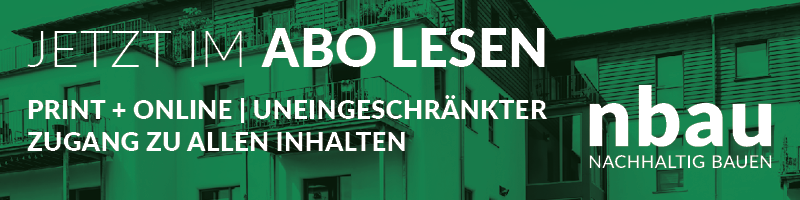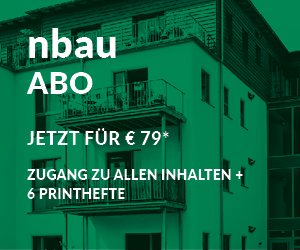concap mit 60 % weniger Konstruktionsbeton als Flachdecke
Die Idee ist nicht neu: Kappendecken oder – wie man sie früher nannte – Preußische Kappen wurden bereits im 19. und frühen 20. Jahrhundert vielfach für Geschossdecken in Wohngebäuden, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bauten eingesetzt. Die traditionelle Kappe, die heute in Yogastudios oder Bürolofts für atmosphärische Räume sorgt, wurde damals als schwere Konstruktion mit Steinen oder Ziegeln ausgefacht. Als Längsträger dienten meist Stahlprofile. Die Errichtung der Decken war zeitaufwendig und erforderte handwerkliches Können. Mit steigenden Lohnkosten gerieten die Kappen in Vergessenheit, mussten schließlich den heute allgegenwärtigen Stahlbetonflachdecken weichen.
Die markante Ästhetik der historischen Kappendecke und das effiziente Tragverhalten inspirierten Mike Schlaich dazu, ein monolithisches Stahlbetonfertigteil zu entwickeln, das den Klassiker in die Moderne übersetzt und wirtschaftliche Fertigungsmethoden ermöglicht. Der Professor für Massivbau an der TU Berlin ist auch Partner im Ingenieurbüro schlaich bergermann partner (sbp), das sich dem Leichtbau verschrieben hat und sich seit vielen Jahren mit dem Tragverhalten von Betonschalen beschäftigt.
sbp fand mit der thomas Gruppe einen erfahrenen Industriepartner, der gewillt war, bei der Entwicklung der modernen Kappendecke zu kollaborieren. Gemeinsam entwickelten sie concap als innovatives und ressourcenschonendes Betonfertigteil. Die Kappendecke trägt durch ihre Gewölbeform als überwiegend druckbelastete Schale. Dadurch können Deckenstärke und Bewehrungsgehalt der Betonfertigteile minimiert werden.
Mehr als ein Jahr dauerte die Produktentwicklung von den ersten Skizzen zur fertigen Ausführungsplanung. Mehrere Prototypen entstanden und verschiedene Großversuche wurden durchgeführt. Im Sommer 2024 wurde bei Berlin ein erstes größeres Demonstrationsprojekt gebaut, ein Anbau an eine Lagerhalle, bei dem fünf große concap-Elemente erfolgreich eingesetzt wurden. Bei dem Projekt konnte das Team wertvolle Erfahrungen zur Planung, Herstellung und Montage der Elemente gewinnen.
Die Idee, eine materialeffiziente Alternative zur Stahlbetonflachdecke zu entwickeln, scheint aufzugehen. concap spart etwa 60 % Konstruktionsbeton gegenüber einer vergleichbaren Flachdecke. Dies wird v. a. durch die geringe Schalendicke zwischen den Längsträgern erreicht. An ihrer dünnsten Stelle beträgt sie nur 6 cm. Um dennoch Anforderungen an Schallschutz, Schwingungsfrequenzen und Brandschutz zu erfüllen, wird auf der Schale eine Schüttung aufgebracht, die aus rezyklierten, ungebundenen Materialien wir Sand, Lehm oder Recyclingbeton besteht. So kann der CO2-Fußabdruck des Gesamtsystems deutlich reduziert werden. Derzeit arbeitet das interdisziplinäre Team daran, die Betonrezeptur zu optimieren, um die CO2-Bilanz weiterzu verbessern.
Das Deckensystem bietet Elemente in verschiedenen Längen, Höhen und Breiten. Spannweiten bis zu 8,1 m sind standardmäßig möglich. Darüber hinaus können weitergehende Ausführungen auf Anfrage geprüft werden. Das Betonfertigteil wird aktuell im Betonwerk in Hennigsdorf nordwestlich von Berlin gefertigt. Künftig sollen weitere Standorte hinzukommen, um die Transportwege zur Baustelle zu verkürzen.
Einer der Vorteile gegenüber der Flachdecke ist, dass Teile der Haustechnik im Hohlraum über der Kappe untergebracht werden können. In Kombination mit einem reversiblen Trockenestrich besteht die Möglichkeit, auf einen Hohl- oder Doppelboden zu verzichten und somit Kosten, Deckenhöhe und CO2 einzusparen.
Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollen die Kappendecken am Ende eines Gebäudelebens ausgebaut und in neuem Kontext wiederverwendet werden können. Für die Zukunft sind daher weitere Großversuche geplant, um den zerstörungsfreien Rückbau der Fertigteile zu erproben.
Die Mischung aus altbewährter Baukunst und moderner Neuinterpretation überzeugte auch die Prüfenden des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt): Im Sommer 2024 erhielt concap eine Typenprüfung des DIBt. Dadurch kann das Fertigteil ohne weitere bautechnische Überprüfung der Elemente in den üblichen Bauvorhaben des Hochbaus eingesetzt werden. Für alle verfügbaren Varianten liegt auch ein Schallschutzgutachten vor.