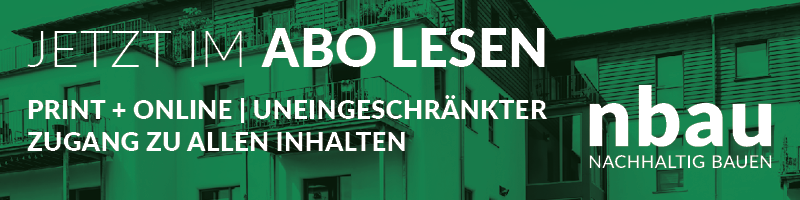Ein Beitrag zum nachhaltigen Bauen
Das Bauen mit Lehm hat auch dank der Normung die industrielle Dimension erreicht. Sowohl der Vorfertigungsgrad als auch die Verarbeitbarkeit der Lehmbaustoffe auf der Baustelle sind vergleichbar mit konventionellen Bauprodukten.
1 Bauen mit Lehm und Lehmbaustoffe
Die bauphysikalischen Eigenschaften des Lehms gewinnen beim zukunftsfähigen Bauen immer größere Bedeutung. Sie ermöglichen dem Planenden einen Lowtech-Ansatz mit Highend-Produkten. Lehmbaustoffe sind energiearm in der Herstellung, lagern CO2 über Pflanzenfaseranteile ein, sind kreislauffähig, bringen thermische Speichermasse in Gebäude und ermöglichen sowohl ein gutes Raumklima als auch einen sommerlichen Wärmeschutz mit weniger Technik (Bild 1). Hinzu kommt die Feuchteabsorptionsfähigkeit des Lehms, die für den Feuchteausgleich sorgt.
2 Rechtlicher Rahmen
Obwohl die Materialität bzw. die Auseinandersetzung mit der Materialwahl für ein zukunftsfähiges und kreislaufgerechtes Planen/Bauen/Sanieren wesentlich ist, wird die sich damit beschäftigende Rechtsmaterie stiefmütterlich behandelt. Die wesentlichen Regelungen sind dem im Bauordnungsrecht der Länder geregelten Bauproduktenrecht zu entnehmen. Unterschieden wird dort zwischen der Verwendbarkeit von Bauprodukten und der Anwendbarkeit von Bauarten (vgl. zur Begrifflichkeit § 2 Abs. 10 und 11 MBO). Weil die Regelung von technischen Bestimmungen im gesetzlichen Rahmen zu detailliert wäre, werden diese in Technischen Baubestimmungen hinsichtlich produktspezifischer Anforderungen an bauliche Anlagen die Standsicherheit, Brandschutz, Gesundheits- und Umweltschutz, Schallschutz und Wärmeschutz betreffend konkretisiert. Das DIBt veröffentlicht die M VVTB. Diese wird von den Ländern als Verwaltungsvorschrift ins Landesrecht umgesetzt. Der Einfachheit halber werden hier die MBO (Musterbauordnung) und M VVTB (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) in Bezug genommen. Beide Muster sind Grundlage für die Landesbauordnungen und die in den Ländern als Verwaltungsvorschrift ergehenden Technischen Baubestimmungen.
Der Einsatz von Bauprodukten in baulichen Anlagen ist erlaubt, wenn Technische Baubestimmungen bestehen, anerkannte Regeln der Technik vorhanden sind oder eine unwesentliche Abweichung von einer eingeführten technischen Regel vorliegt (§§ 16a, 17 MBO). Sofern Bauprodukte/Bauarten nicht oder nicht vollständig hinsichtlich der Bauwerkssicherheit in Normen geregelt sind – genauer: es weder eine anerkannte Regel der Technik noch Technische Baubestimmungen gibt bzw. von einer bestehenden wesentlich abgewichen wird –, sind sie bzw. eine bautechnische Anforderung ungeregelt. Insoweit wird ein Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweis erforderlich. Aus bauordnungsrechtlicher Sicht untergeordnet und daher ungeregelt sind bspw. Lehmanstriche. Umgangssprachlich werden die Nachweise sehr ungenau als Zulassung (abZ, abP, ZiE, aBG, vBG) bezeichnet. Sie sind rechtzeitig vor der Ausführung einer Baumaßnahme bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Diesen Schritt scheuen Planende und Bauunternehmen noch immer zu oft, weil es zeit- und kostenintensiv sein kann. Stattdessen wird auf bekannte Bauprodukte und Bauweisen zurückgegriffen, die sich in den geregelten Strukturen etabliert haben und gleichzeitig für Dilemmata am Bau wie die fehlende Kreislauffähigkeit oder die Energieintensität und damit die hohen Emissionen mit verantwortlich sind.
3 Normen
Lehmbaustoffe haben sich in die bestehende Regelungssystematik integriert. Sie sind ausweislich der darzustellenden Normen geregelt, sodass sie grundsätzlich verwendbar sind. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob alle Anforderungen des Bauordnungsrechts eingehalten sind. Seit der ersten Veröffentlichung der Produktnormen, die auf Grundlage der Lehmbauregeln erarbeitet wurden, ist über ein Jahrzehnt vergangen. Inzwischen liegen sie in dritter Generation aktualisiert vor und haben sich in der Praxis bewährt. Sowohl die Begriffe als auch Übereinstimmungs- und Konformitätsnachweise sind in DIN 18942-1 und DIN 18942-100 formuliert. Dabei regeln die Normen die möglichen Ausgangsstoffe, um die Kreislauffähigkeit des Baustoffs zu erhalten. Neben der energiearmen Herstellung enthalten Lehmbauprodukte CO2-speichernde Pflanzenfaseranteile. Für alle Produktnormen gilt, dass Lehm gemäß DIN 4102-4 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) als nicht brennbar (A1) klassifiziert ist. Ausweislich der folgenden Produktnormen (DIN 18945–DIN 18948) gelten die aus Lehm hergestellten Produkte daher auch dann als nicht brennbar (A1), wenn der Anteil pflanzlicher Zuschläge weniger als 1 % Masseanteil beträgt. Wenn der Masseanteil an pflanzlichen Zuschlägen allerdings höher ist als 1 %, ist die Brandklasse entsprechend DIN EN 13501-1 zu bestimmen. Darüber hinaus gibt es eine Bemessungsnorm für Lehmsteinmauerwerk DIN 18940:2023. Eine solche für Stampflehm ist im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Bundesanstalt für Materialfragen (BAM) in Erarbeitung.