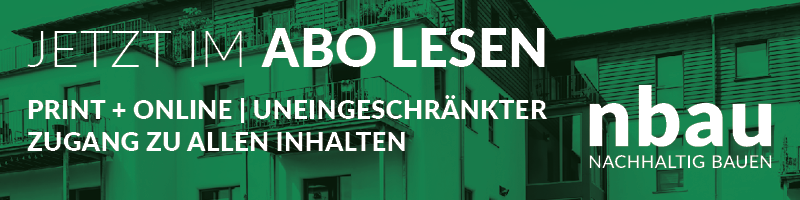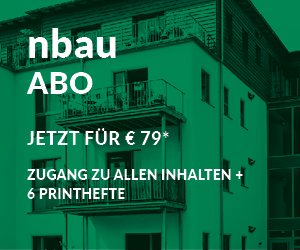Emissionseffizienz statt Energieeffizienz
In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir in Deutschland unzählige Milliarden in die energetische Gebäudesanierung investiert und dabei häufig die Wirtschaftlichkeitsschwelle überschritten. Die Kosten standen nicht im Verhältnis zum Ertrag und zur CO2-Reduktion. Immer noch verfehlt der Gebäudesektor jedes Jahr aufs Neue seine Klimaziele und trägt nach wie vor mit rd. 30 % zu den Gesamt-Treibhausgasemissionen in Deutschland bei. Das zeigt: Wir brauchen dringend einen Paradigmenwechsel!
Beim nachhaltigen Bauen und Betreiben von Gebäuden muss zukünftig der tatsächliche CO2-Verbrauch im Mittelpunkt stehen. Es nutzt nichts, wenn wir ständig die (Dämm-)Standards erhöhen, das Bauen dadurch immer teurer wird, während der CO2-Ausstoß dennoch hoch bleibt. Stattdessen müssen wir das Gebäude mit seinem gesamten Lebenszyklus und seinem gesamten CO2-Fußabdruck in den Blick nehmen. Hierfür ist eine grundlegende Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sinnvoll, wenn nicht sogar essenziell.
Die bisherige Systematik des GEG geht von einem theoretischen Energiebedarf des Gebäudes aus, der sich aus Gebäudehülle (Transmissionswärmeverlusten) und Primärenergiefaktor ergibt. Eine Aussage über den tatsächlichen Treibhausgas- (THG-)Ausstoß wird damit nicht getroffen. Unter dem Aspekt des bezahlbaren Wohnens ist eine Erhöhung der Dämmdicke auf den Effizienzhaus-(EH-)40-Standard nicht sinnvoll. Der energetische Grenznutzen ist laut Studien, z. B. von Prof. Dr. Sven Bienert oder Dietmar Walberg , bereits beim EH-70-Standard erreicht. Aus diesem Grund hat sich die amtierende Bundesregierung auf dem Wohngipfel im September 2023 auch dazu entschieden, den bereits geltenden EH-55-Standard nicht weiter zu verschärfen. Stattdessen müsste eine neue Anforderungssystematik des GEG her, die auf den tatsächlichen THG-Ausstoß abzielt.
Meine Devise lautet also: Emissionseffizienz statt Energieeffizienz – und zwar über den gesamten Lebenszyklus. Das heißt, künftig sollen auch die Energie und die Treibhausgasemissionen in die Berechnung mit einfließen, die bei Herstellung und Transport von Baumaterialien sowie im laufenden Betrieb bis hin zu den Abrissaufwänden entstehen. So fördern wir technologieoffen alle Maßnahmen, die CO2 einsparen und wirtschaftlich sinnvoll sind. Nur so können wir den Konflikt zwischen Bezahlbarkeit und Klimaschutz langfristig lösen. Ansonsten wird das Bauen – und damit auch das Mieten – immer teurer.
Gleiches sollte übrigens auch für unsere Förderprogramme gelten. Auch hier müssen wir den Paradigmenwechsel schaffen und dürfen die finanzielle Förderung des Staats nicht mehr von der Einhaltung bestimmter Primärenergiefaktoren abhängig machen.
Eine pauschale Antwort darauf, wie nachhaltiges Bauen gelingt, gibt es jedoch nicht – eben weil jedes Gebäude individuell geplant und gebaut wird. Schon heute gibt es Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Neben der Umstellung von der Energieeffizienz auf die Emissionseffizienz müssen wir dringend das Quartier stärker in den Blick nehmen. Lösungen für das Quartier gedacht sind oft effizienter und effektiver und damit kostengünstiger. Wenn wir im Kampf gegen den Klimawandel die Kosten nicht im Blick behalten, werden wir die Bürgerinnen und Bürger verlieren.
Das alles ist jedoch nur möglich, wenn im Zentrum der Bemühungen der berühmte Digitale Zwilling der Gebäude und nach Möglichkeit auch der Quartiere steht. Die Antrags-, Genehmigungs- und besonders Planungsverfahren müssen voll digitalisiert und maschinenlesbar werden. Building Information Modeling (BIM) ist ein digitaler Prozess, der den Lebenszyklus eines Projekts vom Entwurf über den Bau bis zur Betriebs- und Wartungsphase optimiert und in einem Digitalen Zwilling bündelt. Damit wird der Bau effizienter, aber auch kostengünstiger. Experten schätzen Kostenersparnisse von bis zu 30 %. Und auf Knopfdruck wäre eine saubere CO2-Bilanz möglich. Die dafür notwendigen Datenbanken und Software gibt es bereits oder können schnell entstehen.
Was vielfach unterschätzt wird: Die Nutzung von BIM bietet darüber hinaus den Vorteil, dass Anpassungen und Änderungen im Genehmigungsprozess schnell und effizient vorgenommen werden können. Dadurch werden Planungen zügig aktualisiert und Bauanträge zeitnah bearbeitet. Insgesamt kann der Einsatz von BIM-Modellen wesentlich dazu beitragen, Verzögerungen in den Genehmigungsphasen zu minimieren und die Effizienz im gesamten Bauprozess zu steigern. Daher haben wir die Nutzung von BIM auch fest im Koalitionsvertrag verankert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umstieg auf emissionsarme Bauweisen nicht nur notwendig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist. BIM erweist sich dabei als ein zentrales Instrument, das die Bauindustrie auf dem Weg zu mehr Emissionseffizienz unterstützen kann. Nur durch die konsequente Implementierung von Emissionseffizienz über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg, von der Materialbeschaffung über den Bau bis hin zur Nutzung und dem Abriss, können wir sicherstellen, dass sowohl ökologische als auch ökonomische Ziele erreicht werden. Ein Paradigmenwechsel hin zur Emissionseffizienz, unterstützt durch den umfassenden Einsatz von BIM, ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Bauwirtschaft.
Autor:in
Daniel Föst, daniel.foest@bundestag.de
Deutscher Bundestag, Berlin
www.daniel-foest.de